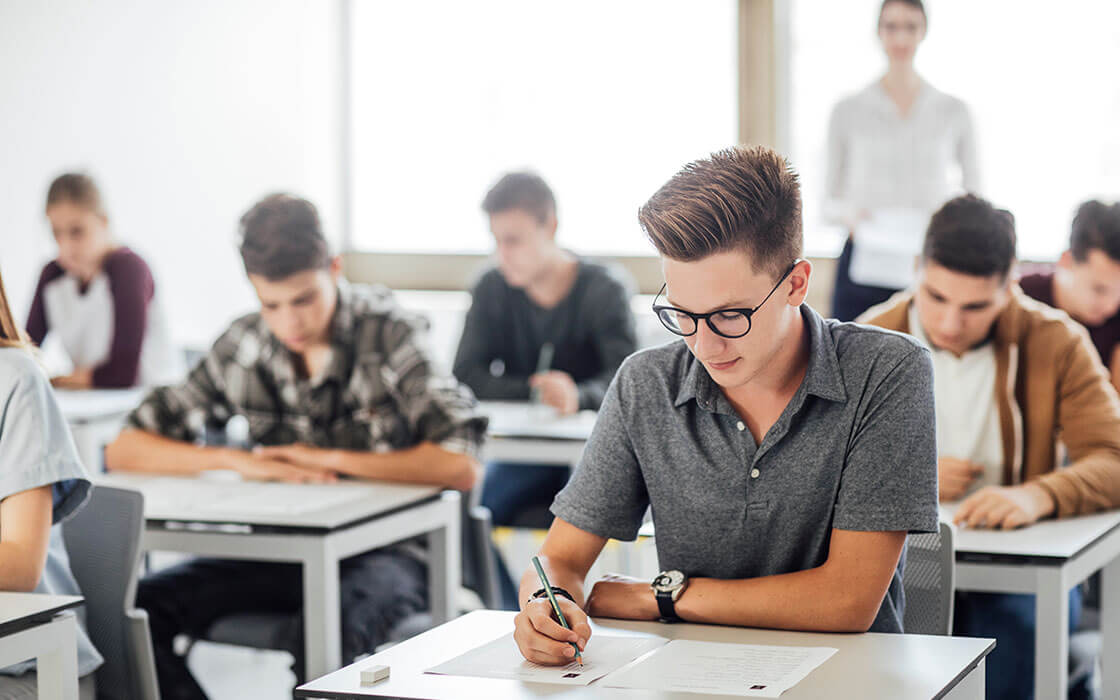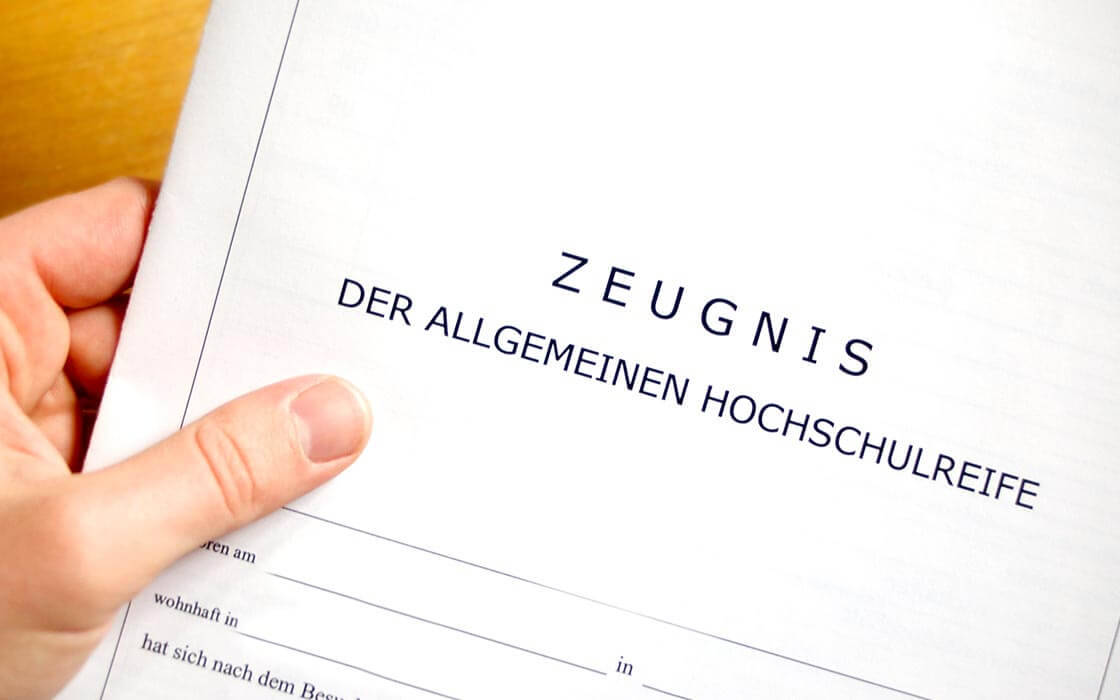Zwischen Schock und neuen Chancen
Digital Natives sind ihren Lehrerinnen und Lehrern in Sachen KI oft um einiges voraus. Doch was bedeutet die neue Technologie für Schülerinnen und Schüler? Welche Folgen hat es, wenn ChatGPT bei den Hausaufgaben hilft? Oder wird es in Zukunft vielleicht sogar die KI-generierte Lehrkraft geben? Durchaus möglich, glaubt Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Stuzubi hat mit ihm gesprochen.
Stuzubi: Gleich zu Anfang einmal ganz allgemein gefragt: Betrachten Sie KI als eine positive Entwicklung, oder stehen Sie dem ganzen eher kritisch gegenüber?
Stefan Düll: Ich scheue mich immer davor zu sagen, eine Innovation ist eher negativ zu bewerten. Nehmen wir mal die Industrialisierung, in der Summe hat das einen enormen Zuwachs an Wohlstand gebracht. Im Allgemeinen ist das Positive, was aus diesen Innovationen herauskommt, gigantisch, und das ist bei KI genauso.
Stuzubi: Gilt das auch für die Schule? Dazu gibt es aktuell ja auch kritische Stimmen.
Stefan Düll: Auch hier kann man in die Geschichte zurückblicken, der Buchdruck, Rundfunk, Fernsehen, das alles hat einer breiten Masse zu Wissenswohlstand verholfen. Bildung wurde leichter verfügbar. Und so ist es mit dem Internet auch. KI geht dann noch eine Stufe weiter. Das sind irrsinnige Chancen, und da muss Schule natürlich drauf reagieren.
Stuzubi: Also ist es in Ordnung, wenn Jugendliche in der Schule KI benutzen?
Stefan Düll: KI kann hilfreich sein, wir müssen aber darauf achten, dass – man muss es so formulieren – der Schüler dabei nicht verdummt. Wir werden auch Schüler haben, die KI auf einem sehr hohen Niveau einsetzen, das sind aber unsere üblichen Überflieger. Die sind sowieso gut, weil die sich insgesamt mit dieser gesellschaftlichen Herausforderung, die IT mit sich bringt, auf einem ganz anderen Level beschäftigen. Die sind auch in der Lage, ein Ergebnis zu beurteilen, das die KI generiert hat. Das heißt, sie haben das grundsätzliche Wissen, die grundsätzlichen Kompetenzen, selber gelernt und sind deshalb so gut im Umgang mit KI, weil sie beurteilen können, ob die Ergebnisse was taugen oder nicht.
„Wir dürfen KI nicht verteufeln“
Stuzubi: Aber was ist mit den weniger ambitionierten Jugendlichen, profitieren die auch von den neuen technischen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz?

Stefan Düll: Unsere große Herausforderung werden all diejenigen sein, die überhaupt keinen Bock haben, sich in irgendeiner Weise auf das System Schule einzulassen. Die sind aber auch jetzt schon unsere Herausforderung. Für die ist Erlebnispädagogik unter Umständen eher das Richtige. Schule ist insgesamt so aufgebaut, dass ich Dinge lerne, die ich später vielleicht nicht unmittelbar anwenden kann. Aber die damit vermittelten Kompetenzen zum Beispiel in Analyse und Textverständnis helfen mir dann dabei, auch eine Steuererklärung zu machen und einen Versicherungsvertrag zu verstehen. Oder: Geometrie und das Training der räumlichen Vorstellungskraft helfen mir bei der Wohnungseinrichtung.
Wir vermitteln Grundkompetenzen. Und genau damit haben manche Menschen tatsächlich ein großes Problem. Ob uns KI helfen kann, darüber hinwegzukommen, weil der Unterricht dadurch mehr Realitätsbezug bekommt? Das müsste man abwarten. Aber es ist ein Fehler, anzunehmen, dass KI eine völlig neue Art von Schülern geschaffen hat. Die Schüler sind dieselben. Auch wenn KI scheinbar den Schülerinnen und Schülern Arbeit abnimmt, müssen sie stattdessen lernen, die Resultate der KI einzuschätzen und weiterzuentwickeln. Wir dürfen nicht die KI verteufeln und sagen, hey, hallo, das wird ja alles schlimmer. Nein, wird es nicht, es wird nur anders, und wir müssen darauf reagieren.
Stuzubi: Und wie?
Stefan Düll: Für Lehrer ist es mitunter ein Schockerlebnis, wenn sie mitbekommen, dass Schüler viele Aufgaben nur noch mit KI erledigen. Wenn wir als Schule KI aber als ein unterstützendes Element begreifen, vereinfacht gesprochen wie einen Taschenrechner, und wir die Welle mitreiten, dann entsteht eine neue Kultur im Umgang damit. Ich kann als Lehrer KI bewusst in der Hausaufgabe einsetzen, zum Beispiel eine Lösung servieren, und die Schüler müssen den richtigen Prompt (Fragestellung für KI, Anm. d. Red.) dafür entwickeln.
Momentan sind wir aber noch an dem Punkt, dass wir versuchen, das alte System aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn wir mitbekommen, dass jemand mit KI die Aufgaben erledigt hat, dann wird es thematisiert, dann werden die Eltern kontaktiert et cetera. In den Schulbüchern sind noch Aufgaben der klassischen Art. Und neue Aufgaben zu machen, die man mit KI nicht so einfach lösen kann oder die KI sinnvoll mit einbinden, das kann von den Beteiligten, den Schulbuchverlagen und Lehrkräften, nicht so schnell umgesetzt werden.
Stuzubi: Aber können nicht auch Lehrerinnen und Lehrer KI als Tool für ihre Unterrichtsvorbereitung nutzen?
Stefan Düll: Als Lehrkraft kann ich mir das Leben sehr viel leichter machen, wenn es mir gelingt, KI vernünftig einzusetzen. Aber wir bewegen uns da in einer Grauzone. Es gibt noch keine Standardisierung von KI für die Schulen. Vielfach experimentieren die Lehrkräfte mit selbst beschaffter KI. Es hängt davon ab, wie intensiv sich der Einzelne schon damit beschäftigt. Was die Kollegen dafür brauchen, ist aber Zeit, um das zu üben und zu lernen. Und die fehlt eben vielfach.
Stuzubi: Sie sagen, Jugendliche haben sich im Zeitalter von KI nicht grundlegend verändert. Trifft das auch auf Lehrkräfte zu, oder braucht es jetzt neue Lehrerinnen und Lehrer – vielleicht sogar KI-generierte?
Stefan Düll: Wenn ich jetzt behaupte, nein, dann kann sich dieses Nein nur auf die absehbare Zeit beziehen. KI wird eine Rolle im schulischen Leben einnehmen, nicht heute, noch nicht in fünf Jahren. Für einen Teil der Schüler schließe ich aber nicht aus, dass sie mit einer KI-Person vielleicht besser klarkommen als mit einem Lehrer und einer Klasse. Ein Thema kann das auch in Bundesländern wie Sachsen und Sachsen-Anhalt sein, die nicht genügend Lehrer haben und wo die Schüler einen Tag in der Woche deshalb digital gestützt alleine zu Hause arbeiten.
Ob wir in 30 Jahren noch ausschließlich Unterricht mit realen Lehrern machen, oder ob zusätzlich KI-Personen als individuelle Unterstützung mit hineinspielen – ich kann mir gut vorstellen, dass es das geben wird. Was aber Corona gezeigt hat, ist, dass wir in der Schule neben der Vermittlung von Wissen und Entscheidungskompetenzen die Beziehungsarbeit und die unmittelbare menschliche Begegnung brauchen. Mit der Lehrkraft, und zwar ob wir sie mögen oder nicht, und untereinander mit den Mitschülern.
Das Interview führte Julia Stark.
Berufsorientierung mit Stuzubi: Messen | Magazine | Online
Seit mehr als 30 Jahren unterstützt Stuzubi Schülerinnen und Schüler bei ihrer Berufsorientierung: mit Berufsorientierungsmessen in ganz Deutschland, aber auch mit Medien wie dem Stuzubi Online Magazin, dem Stuzubi YouTube Kanal, dem Stuzubi Orientierungstest, Webinaren zur Berufsorientierung und vielen weiteren nützlichen Tools. Alle Angebote von Stuzubi sind für Schülerinnen und Schüler kostenfrei.