Sich im Selbstverteidigungsseminar aus einem Würgegriff befreien, im Praktikum Leichen abtasten oder sich in einer Vorlesung durch Strafrechtsparagraphen kämpfen: Für ihr duales Studium braucht Phiebi Behrend starke Nerven und einen kühlen Kopf. Dafür hat sie nach ihrem Abschluss einen der spannendsten Berufe, die es gibt: Die 22-Jährige wird gerade bei der Berliner Polizei zur Kriminalkommissarin ausgebildet.
Ihrem Berufswunsch bekam Phiebi eigentlich schon mit in die Wiege gelegt. „Meine Eltern sind beide bei der Polizei“, sagt sie. Dennoch sei es kein Kindheitstraum von ihr gewesen, später einmal selbst Polizistin zu werden, räumt sie ein. Entschieden habe sie sich für den Beruf aber schon relativ früh. Mit 15 Jahren habe sie beim Girls Day, bei dem sich Mädchen einmal im Jahr über sogenannte typische Männerberufe informieren können, die Polizeidienststelle ihrer Mutter besucht: „Da war es dann klar.“
Nach dem Abi bewarb sie sich für ein duales Studium zur Kriminalkommissarin. Dual zu studieren habe viele Vorteile, sagt sie: „Wichtig war mir vor allem der Praxisbezug.“ Eine Rolle spiele für viele auch der finanzielle Aspekt – denn die Studierenden bekommen von Anfang an ein Gehalt. Die teuerste Wohnung in Berlin könne man sich anfangs davon zwar nicht leisten, „aber zum Leben reicht es.“
Allerdings sind duale Studienplätze begehrt. Im öffentlichen Dienst gibt es deshalb umfangreiche Einstellungstests. „Auch wenn man eigentlich alles bestanden hat, kann es sein, dass jemand anders in einem Testteil besser war und man dann aufgrund der Rangliste nicht genommen wird“, erklärt Phiebi.
Der Einstellungstest: Logik, Sprache und Sport
Bei ihr hat es jedoch auf Anhieb geklappt. Den ersten Teil des Tests absolvieren die Bewerber*innen zuhause am PC. „Das sind größtenteils Logik- und Denkaufgaben“, berichtet Phiebi. Vorbereitet habe sie sich darauf nicht. Regelmäßig trainiert habe sie für den Einstellungstest und den Hindernisparcours. Der Einstellungstest findet in der Keibelstraße statt, zu dem die Bewerber*innen eingeladen werden, die den Onlinetest bestanden haben. Da gebe es unter anderem noch einmal Logikaufgaben und ein Diktat – denn gute Deutschkenntnisse sind für den Beruf eine zwingende Voraussetzung.
Danach gehe es direkt zum Hindernisparcours bei der Polizeiakademie, bei dem die sportliche Eignung der Teilnehmer*innen geprüft werde. Um sich darauf vorzubereiten, sei sie regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen und habe Kardio- und Krafttraining gemacht. Danach folgen bei einem dritten Termin umfangreiche medizinische Tests. Unter anderem findet ein Belastungs-EKG statt und das Seh- und Hörvermögen wird untersucht. Im Bewerbungsgespräch werden dann unter anderem mögliche Situationen aus dem Polizeialltag beschrieben, und die Teilnehmer*innen erklären, wie sie in den jeweiligen Fällen reagieren würden. Konkrete Beispiele dürfe sie dazu aber nicht verraten, erklärt Phiebi.
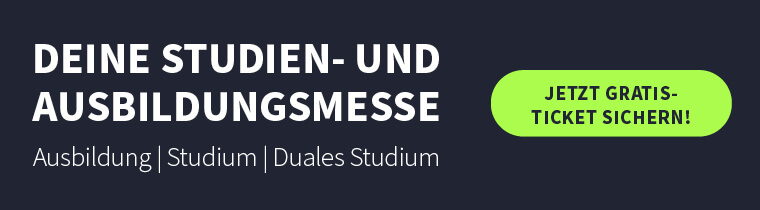
Gerüstet für den Polizeialltag: Schießtraining, Leichenobduktion und Büroarbeit
Im Studium werden die künftigen Kriminalkommissar*innen in Seminaren auf den Polizeialltag vorbereitet. Die Seminare finden in den Semesterferien statt und beinhalten zum Beispiel Schießtraining, Erste-Hilfe-Kurse oder auch Verhaltens- bzw. Situationstrainings. „Hier lernen wir, was man macht, wenn einem jemand die Waffe wegnimmt, wie man bei einem Messerangriff reagiert oder wie man erste Hilfe bei verletzten Personen leistet.“ Nach Geschlechtern getrennt wird dabei nicht. Ganz im Gegenteil empfehle der Seminarleiter gerade auch den Mädchen, nicht immer nur mit der besten Freundin, sondern auch einmal mit einem männlichen Kollegen zu üben. „Wenn man die richtige Technik beherrscht, kann man sich als Frau auch gegen einen Mann zur Wehr setzen“, sagt Phiebi.
Den realen Arbeitsalltag bei der Polizei lernen die Studierenden bei Praktika in Berliner Dienststellen kennen. Beim ersten Praktikum im dritten Semester stehe das Thema Sachbearbeitung auf dem Programm. Hier gehe es vor allem um Bürotätigkeiten im Rahmen von Ermittlungen oder bei der Befragung von Zeugen. Denn was viele nicht wissen: Bei der Kriminalpolizei fällt relativ viel Schreibtischarbeit an. Der Anteil verwaltender Aufgaben liege bei 70 bis 80 Prozent, berichtet Phiebi: „Bei uns wird viel ermittelt, dokumentiert und es werden lange Sachverhalte geschrieben.“ Sie selbst habe dieses Praktikum im Bereich Jugendkriminalität absolviert und zum Beispiel Fälle von Fahrerflucht und Drogendelikten bearbeitet.
Beim zweiten Praktikum im fünften Semester geht es ans Eingemachte. Die angehenden Kriminalkommissar*innen bekommen eine*n erfahrenen Partner*in zugeteilt und ermitteln erstmals auf der Straße. Hier komme man mit den Schattenseiten des Lebens in Kontakt: Gewaltverbrechen, Sexualstraftaten, Einbrüche, Selbstmorde und mehr. Darauf vorbereitet werden die Studierenden mit Kursen in der Gerichtsmedizin, bei denen sie unter anderem auch bei einer Leichenobduktion dabei sind.
„Aber wenn man dann eine tote Person in einer Wohnung auffindet, ist das nochmal was ganz anderes“, sagt Phiebi. Allerdings habe sie ihre Partnerin behutsam an die Situation herangeführt. Grundsätzlich gehöre es zu den Aufgaben der Kommissar*innen, die Verstorbenen zu entkleiden, abzutasten und nach Fremdeinwirkung und Verletzungen zu suchen: „Aber das hat am Anfang meine Partnerin übernommen und ich musste nur die Fotos machen.“
Als Kriminalkommissar*in erste Ansprechpartnerin für die Opfer: Wie kleine Hilfen viel bewirken
Doch wie kommt man mit einem Beruf zurecht, der einen immer wieder mit Leid und Tod in Berührung bringt? „Das ist unterschiedlich, jeder geht damit anders um“, sagt Phiebi. „Ich persönlich mache andere Aufgaben lieber, aber es gehört natürlich zu meinem Beruf dazu und ich komme damit klar und nehme diese Dinge nicht mit nach Hause.“ Hilfreich sei in solchen Situationen auch, sich an die Kolleginnen und Kollegen im Team zu wenden: „Wir können untereinander immer darüber sprechen, wenn uns etwas belastet oder hilfreich ist auch ein Ausgleich im Privaten.“ Bei Bedarf gebe es auch jederzeit professionelle Unterstützung, etwa wenn bei einem Einsatz der Gebrauch von Schusswaffen nötig gewesen sei. Niemand werde mit seinen Problemen allein gelassen.
Was sie motiviert, sich beruflich solchen Extremsituationen auszusetzen? Als Polizistin könne sie den Menschen in diesen Notlagen beistehen und helfen, erklärt Phiebi. Schon mit kleinen Dingen könne sie oft viel bewirken, etwa, indem sie Betroffenen nach Einbrüchen gut zurede: „Oder einmal war ein Mädchen nach einem Sexualdelikt völlig aufgelöst. Indem ich mit ihr gesprochen habe, konnte ich alles zumindest etwas erträglicher machen.“
Ein kleines „Jurastudium“ – mit Kriminalistik und Psychologie
An der Hochschule gehe es im dualen Studium zum/zur Kriminalkommissar*in viel um rechtliche Themen. „Das ist fast wie ein kleines Jurastudium“, sagt Phiebi. Sie hat Lehrveranstaltungen zum Strafgesetzbuch, über Polizei- und Ordnungsrecht und weitere juristische Fächer. Diesen Teil des Studiums finde sie am schwierigsten: „Ich hatte vorher nie mit Paragraphen zu tun.“ Allerdings sei sie gut an das Thema herangeführt worden: „Und wenn man mal drin ist, wird es auch interessant und es macht Spaß, die Fälle zu lösen.“
In Kriminologie und Kriminalistik lernen die Studierenden beispielsweise, wie man Spuren am Tatort sichert oder wie man mit Zeugen umgeht. Auch Soziologie und Psychologie gehören zu den Studieninhalten: Die angehenden Kriminalkommissare erfahren, welche psychischen Krankheiten und Auffälligkeiten es gibt, und was im Umgang mit den Betroffenen zu beachten ist. „Psychologie macht mit am meisten Spaß“, schwärmt Phiebi.
Vorgesehen sei während der Hochschulphasen ein Zeitaufwand von rund 40 Wochenstunden – inklusive Lehrveranstaltungen und Lernen. Anfangs sei es etwas mehr, später werde es dann entspannter. Hinzu komme vereinzelt noch die Vorbereitung von Vorträgen oder Hausarbeiten. Jedoch werden Klausuren innerhalb der Lehrveranstaltungen intensiv geübt anhand von Aufgaben aus den Vorjahren: „Und wenn jemand mal durchfällt, gibt es automatisch Nachhilfe.“ Insgesamt sei das Studium gut machbar, „aber man muss schon lernen, damit es funktioniert.“
Mordkommission oder Presseabteilung? Berufliche Möglichkeiten für Kriminalkommissar*innen nach dem Abschluss
Doch der Einsatz lohne sich. Als Kriminalkommissarin erlebe sie jeden Tag etwas anderes: „Man weiß nie, was kommt.“ Zu den schönen Seiten ihres Berufs gehöre auch der besondere Zusammenhalt im Team. Schüler*innen, die sich für das duale Studium bei der Polizei interessieren, sollten jedoch einen gewissen Ehrgeiz mitbringen: „Hinterhergeworfen wird einem nichts.“ Auch müsse man sich im Klaren darüber sein, dass man mit schwierigen Themen zu tun haben werde: „Tod, Sexualdelikte, Messerangriffe, solche Dinge wird man sehen.“ Wichtig seien außerdem Teamfähigkeit, Begeisterung für Sport und der Wunsch, immer wieder Neues zu erleben.
Nach dem Studium sind die Möglichkeiten allerdings vielfältig. Begehrt seien vor allem Einsatzgebiete wie die Mordkommission oder organisierte Kriminalität. Aber auch ganz andere Wege stehen den Absolvent*innen offen. Sie selbst könne sich zum Beispiel auch eine Tätigkeit bei der Presseabteilung der Polizei vorstellen, sagt Phiebi: „Oder ich sehe mich vielleicht auch als Dozentin an der Polizeiakademie.“ Vorher wolle sie aber noch einige Jahre Berufserfahrung sammeln. In welchem Einsatzbereich – das lässt sie sich vorerst noch offen.
Duale Studiengänge im öffentlichen Dienst auf der Berufsorientierung Stuzubi
Wie ein duales Studium zum/zur Kriminalkommissar*in abläuft und welche Studiengänge es im öffentlichen Dienst sonst noch gibt, erfährst du auf der Studien- und Ausbildungsmesse Stuzubi. Termine und Gratis-Tickets







